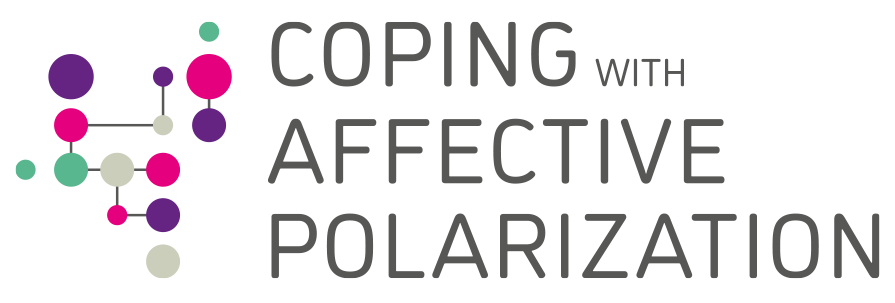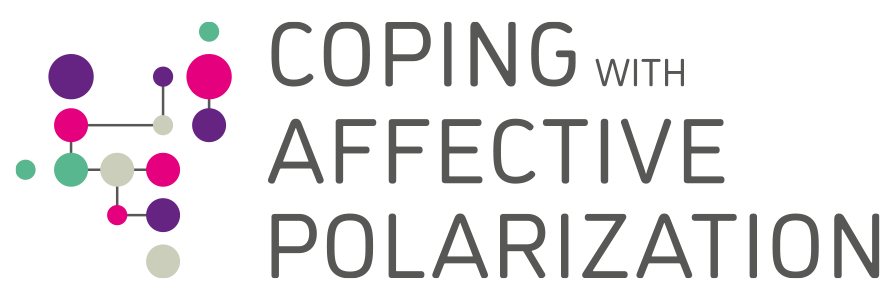Projektverantwortung:
Prof. Dr. Hanna Schwander
Projektleitung:
Prof. Dr. Thorsten Faas, Prof. Dr. Denis Gerstorf, Prof. Dr. Hanna Schwander, Prof. Dr. Jule Specht, Prof. Dr. Céline Teney
Postdoktorand:innen:
Dr. Bastian Becker
Doktorand:innen:
Luke Shuttleworth
Basierend auf einer umfangreichen, langfristigen Panelbefragung, die Zugehörigkeitsgefühle zur eigenen Gruppe sowie Ablehnung gegenüber Personen aus anderen Gruppen erfasst, bildet der Berliner Polarisierungsmonitor die zentrale Dateninfrastruktur unserer Einstein Research Unit. Mit dem Fokus auf Polarisierungstrends in ganz Deutschland schließt unser Monitor eine wichtige Lücke bei den Langzeitdaten zur affektiven Polarisierung in demokratischen Mehrparteiensystemen.
Forschungsfragen und Ziele
Der Berliner Polarisierungsmonitor erfasst sowohl das Ausmaß als auch die Dynamik affektiver Polarisierung und stellt dabei Fragen wie:
Unser Polarisierungsmonitor ermöglicht die Analyse verschiedener Dimensionen affektiver Polarisierung, insbesondere im Zusammenhang mit emotional aufgeladenen Themen – von langanhaltenden Debatten (z. B. zum Klimawandel) bis hin zu aktuellen Ereignissen wie der Bundestagswahl oder dem Krieg in der Ukraine. Neben der Bereitstellung wertvoller Daten für die wissenschaftliche Forschung wird der Polarisierungsmonitor seine Ergebnisse regelmäßig in die Öffentlichkeit tragen und damit eine evidenzbasierte Grundlage für laufende Diskussionen über Meinungsbilder und Polarisierung in Deutschland bieten. Der Berliner Polarisierungsmonitor konzentriert sich dabei insbesondere auf drei zentrale Ziele:
Methodischer Ansatz
Der Berliner Polarisierungsmonitor verwendet eine innovative Methode zur Untersuchung affektiver Polarisierung in Deutschland. Seit Januar 2025 erfasst eine umfangreiche Panelbefragung Polarisierungstrends sowohl auf individueller als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Der Polarisierungsmonitor misst empirisch Zugehörigkeitsgefühle zur eigenen Gruppe, Ablehnung gegenüber anderen Gruppen sowie damit verbundene Emotionen zu politischen Themen und Parteien. Dabei werden sowohl langjährige Debatten wie Klimawandel und Migration als auch neue Herausforderungen durch Krisen – etwa den russischen Krieg in der Ukraine, die wachsende Infragestellung der Demokratie oder die Schuldenbremse – betrachtet.
Unser methodisches Vorgehen garantiert eine besonders belastbare und vergleichbare Datenbasis, mit der wir soziale Spaltungen und ihre psychologischen sowie soziologischen Grundlagen erfassen können. Die längsschnittliche Datenstruktur ermöglicht es, individuelle Veränderungen sowie Unterschiede zwischen Gruppen zu analysieren. So gewinnen wir Einblicke in die sich wandelnde Natur affektiver Polarisierung, ihre ideologischen und emotionalen Facetten sowie mögliche Folgen im Verhalten.
Forschungsbereiche