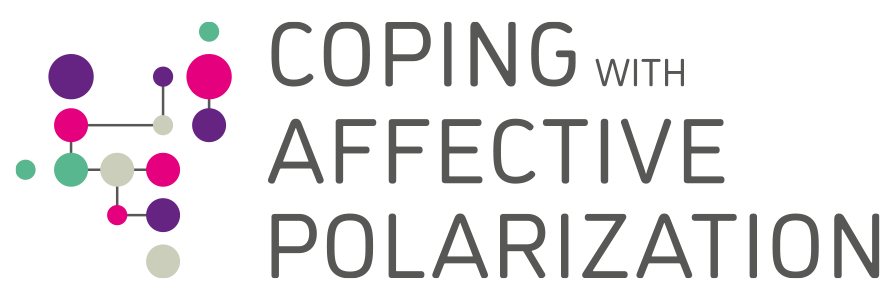Warum fühlen sich viele Menschen heute stärker zu Gleichgesinnten hingezogen – und lehnen Andersdenkende immer deutlicher ab? Welche Folgen hat das für ein demokratisches Miteinander? Und vor allem: Was können wir dagegen tun? Diesen Fragen widmet sich unser Forschungsverbund – und damit auch das neue Diskussionspapier „Coping with Affective Polarization. A Research Program“, verfasst vom Sprecher:innen-Team unserer Einstein Research Unit.
Die Veröffentlichung gibt einen kompakten Überblick über unser Forschungsprogramm und die übergeordneten Ziele. Daneben werden die theoretischen und empirischen Grundlagen erläutert, auf denen unsere Projekte aufbauen. So wird unter anderem das gemeinsame Verständnis zentraler Konzepte dargelegt – etwa, welche Definition von affektiver Polarisierung unserer Arbeit zugrunde liegt.
Die Autor:innen zeigen zudem auf, warum sich Tendenzen zur affektiven Polarisierung in heutigen demokratischen Gesellschaften verstärken – und welche Möglichkeiten es gibt, mit ihren negativen Auswirkungen umzugehen. Dabei argumentieren sie, dass sozialer Zusammenhalt eine zentrale Ressource ist, um affektive Polarisierung konstruktiv zu bewältigen und ihren negativen Folgen entgegenzuwirken – und dass die Zivilgesellschaft dabei eine Schlüsselrolle spielt, sowohl bei der Stärkung des sozialen Zusammenhalts als auch bei seiner Erforschung.
Das Diskussionspapier bildet damit den Ausgangspunkt für unser Forschungsprogramm: Durch fundierte wissenschaftliche Analysen und die Entwicklung praxisnaher Ansätze wollen wir affektive Polarisierung nicht nur besser verstehen, sondern auch konkrete Werkzeuge bereitstellen, mit denen Einzelpersonen wie auch gesellschaftliche Gruppen konstruktiv damit umgehen können.
Das Papier ist ab sofort frei über die Bibliothek des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) verfügbar!
PDF-Download: Grundlagenpapier, 2025
Empfohlene Zitierweise:
Hutter, S., Schwander, H., Specht, J., von Scheve, C. (2025). Coping with Affective Polarization: A Research Program. Discussion Paper ZZ 2025-602, WZB Berlin Social Science Center.